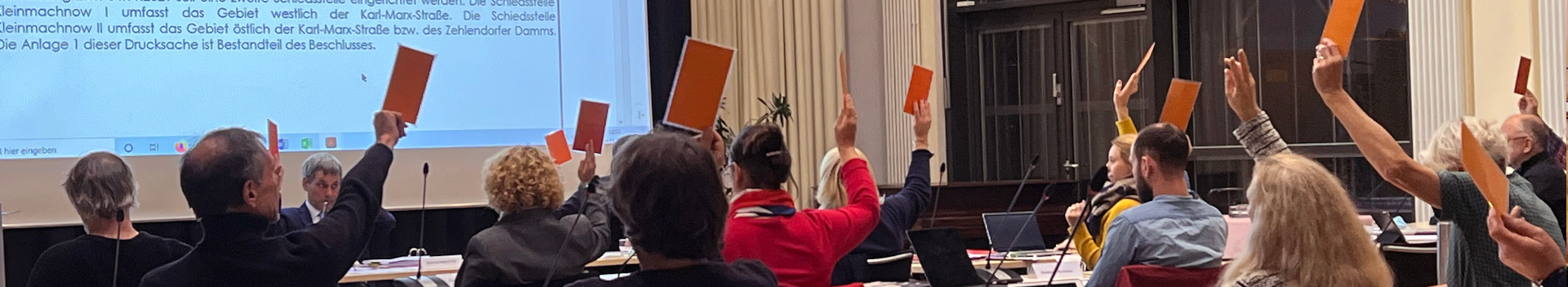Positionspapier zur Entwicklung der brandenburgischen Innenstädte
Durch die Corona-Pandemie wird sich die Situation in den Innenstädten und Ortskernen der brandenburgischen Städte und Gemeinden stark verändern. Entwicklungen, die bereits durch veränderte Einkaufsmodalitäten begonnen haben, wurden durch die temporären Einzelhandelsschließungen im Lockdown verstärkt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die neue Rolle des Onlinehandels. Diese wird auch in Zukunft eine wesentlich größere Bedeutung haben und kombiniert mit der Corona-Pandemie folgenden finanziellen Schwierigkeiten lokaler Gewerbetreibender und Gastronomen die Innenstädte und Ortskerne vor große Herausforderungen stellen. Insbesondere kleine Einzelhändler werden betroffen sein. Der Strukturwandel ist anzuerkennen. Darauf muss reagiert werden und die Thematik aktiv angegangen werden.
Diese Herausforderungen müssen gemeinsam gemeistert werden, angesprochen sind dabei sowohl Städte und Gemeinden als auch Bürgerinnen und Bürger, Hauseigentümer, Gewerbetreibende sowie das Land und der Bund. Städte und Gemeinden begleiten diesen Prozess im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Es stellt sich die Frage, wie das Land Brandenburg eine positive Unterstützung zu den anstehenden Veränderungen leisten und die Städte und Gemeinden beim anstehenden Prozess begleiten kann. Bei der Bewältigung der Corona-Folgen soll exemplarisch auf das 2020 in Nordrhein-Westfalen (NRW) aufgelegte Sofortprogramm verwiesen werden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat hier 70 Million € zur Verfügung gestellt, um so die Städte und Gemeinden bei verschiedenen Maßnahmen mit ein Fördersatz von 90 % zu unterstützen.
Auf Bundesebene wurde ein Bundesprogramm zur Stärkung der Innenstädte beschlossen und dafür 25 Millionen € veranschlagt. Hier wird jedoch der Fokus auf der Förderung einiger weniger Modellprojekte liegen. Dies ist zwar grundsätzlich interessant, sollte jedoch für Brandenburg nicht als Blaupause genommen werden, da mit Modellprojekten die Mehrheit zu unterstützender Kommunen nicht erreicht werden kann.
1. Langfristige Konzepte entwerfen
Die Veränderung der Innenstädte erfordert, dass der Lebensraum einer Innenstadt oder eines Ortskernes neu gedacht wird. Städte, Gemeinden und Ämter unternehmen bereits vielfach Anstrengungen, Prozesse anzustoßen und Veränderungen mit zu entwickeln. Mit einem Wegfall Gewerbetreibender entstehen neue Freiflächen, die genutzt werden können und sollten. Es bieten sich neue Möglichkeiten, aber gleichzeitig besteht auch die Gefahr der Verödung der Stadtzentren, wenn keine Anpassung an die sich verändernden Gegebenheiten erfolgt. Die Einkaufsstädte müssen eine neue Bestimmung finden. Ein Ortskern ist essenziell für Städte und Gemeinden, der Marktplatz stellt dabei ein historisches Zentrum dar. Auch in der Zukunft ist ein solcher Ort zum Austausch wichtig für die Menschen. Um lebendige Innenstädte zu haben, können verschiedene Herangehensweise gewählt werden. So können kulturelle, historische und touristische Aspekte eine große Anziehungskraft haben, für die Bevölkerung vor Ort werden jedoch vor allem Kriterien, wie medizinische und therapeutische Einrichtungen und Dienstleistungsbetriebe wichtig sein. Vielfach werden auch bereits Schwerpunkte auf regelmäßige Veranstaltungen, Festivals und ähnliches als Besuchermagneten gesetzt, die die Attraktivität der Innenstädte heben. Die vermehrte Ansiedlung von Behörden und kommunalen Einrichtungen in zentraler Lage kann dazu beitragen, die Zentren lebendiger zu halten und für stetigen Publikumsverkehr zu sorgen. Wo dies möglich ist, sollten entsprechende Nutzungen durch die Städte und Gemeinden gesteuert und gezielt zentral verortet werden.
Auch andere Aspekte, wie die Erreichbarkeit und Infrastruktur, spielen eine Rolle. Dabei sollte auch ein Augenmerk darauf gerichtet werden, dass nicht durch Verlagerung an den Ortsrand eine Konkurrenz für die Innenstädte und Ortszentren geschaffen wird und somit eine negative Entwicklung verstärkt wird. Städte und Gemeinden unternehmen bereits vielfältige Anstrengungen, um ihre Ortskerne attraktiv zu erhalten. Neue, wirtschaftlich tragfähige, Nutzungen müssen erschlossen werden. Dieser Prozess sollte auch durch das Land weiter aktiv begleitet werden.
2. Konkrete Maßnahmen ergreifen
Um direkte und zeitnahe Auswirkungen der Corona-Pandemie aufzufangen, sollte das Land Brandenburg die Städte und Gemeinden speziell unterstützen. Angelehnt an das Sofortprogramm von NRW könnte ein Innenstadtfonds in Betracht kommen. Mit einem solchen könnten Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die Situation in besonders betroffenen Regionen zu verbessern. Dies würde Städten und Gemeinden die Möglichkeit geben, vor Ort konkret und zeitnah auf die jeweiligen Bedürfnisse des Handels einzugehen. Mit einem solchen Fonds würden neue Handlungsspielräume entstehen, mit denen durch die Gemeinden auf lokaler Ebene durch zeitnahe und unbürokratische Maßnahmen unterstützt werden kann.
Andere Varianten, mit denen Städten und Gemeinden geholfen werden könnte, bei Leerständen einzugreifen, haben bereits in NRW Aufnahme in das Sofortprogramm gefunden. Zu nennen wäre beispielsweise die vorübergehende Anmietung leerstehender Ladenlokale zur Etablierung neuer Nutzungen und einer Weitervermietung zu reduzierter Miete. Auch der Zwischenerwerb von Einzelhandelsimmobilien, der es Gemeinden ermöglicht, leerstehende Gebäude mit bedeutender Lage oder besonderem Erscheinungsbild zu erwerben und so Immobilienspekulation vorzubeugen, wäre eine mögliche Maßnahme. Generell kommunale Vorkaufsrechte zu stärken, ist ein anderer Aspekte, der die gemeindliche Ebene unterstützen würde. Zwischennutzungen sollten generell unterstützt und gefördert werden können.
Ein weiteres Instrument könnten Business Improvement Districts (BIDs) darstellen, mit denen Impulse für die Stadtentwicklung gegeben werden können. Dabei handelt es sich um räumlich definierte Gebiete, in welchen die Grundeigentümer und Gewerbetreibenden durch eine selbst auferlegte und zeitlich befristete Sonderabgabe versuchen, die Standortqualität zu erhöhen und die grundlegenden Probleme von benachteiligten Standortlagen anhand von Projekten zu verbessern. In Brandenburg existiert bisher noch keine landesrechtliche Regelung zu BIDs, während verschiedene andere Bundesländer bereits eigene BID-Gesetze erlassen haben. Die Einführung eines solchen Gesetzes könnte neue Impulse ermöglichen.
Ein Baustein, der bei der Entwicklung der Innenstädte helfen könnte, wäre auch die Flexibilisierung der Sonntagsöffnungszeiten. Auch weitere kleinteilige Maßnahmen, die auf die Besonderheiten der brandenburgischen Städte und Gemeinden zugeschnitten sind, sollten erarbeitet werden.
3. Anstrengungen unterstützen
- Städtebauförderung
Als wichtige Unterstützung käme in Betracht, dass das Land den Eigenanteil der Kommunen im Rahmen der Städtebauförderung übernimmt. Dies würde für die Städte und Gemeinden eine wesentliche Erleichterung bedeuten, die freiwerdenden Mittel könnten flexibel für Bedarfe, die in den Innenstädten entstehen, genutzt werden. Auch der Verfügungsfonds aus der Stadtbauförderung könnte als Instrument dienen. Hier sollen Zugriffsmöglichkeiten und Modalitäten überprüft werden. Grundsätzlich wäre auch eine generelle Erhöhung der Städtebaufördermittel hilfreich. Insbesondere finanzschwache Gemeinden sollten besonders in den Blick genommen und die Modalitäten entsprechend angepasst werden, damit Eigenanteile reduziert werden können.
Da die oben genannten Mittel nur die Städte erfassen würden, die in die Kulisse der Städtebauförderung fallen, muss auch für die anderen Kommunen eine Förderung ermöglicht werden.
- Innenstadtfonds
Um kurzfristig und flexibel auf die Situation eingehen zu können, wenn die Corona-Pandemie sich etwas entschärft, wäre der bereits genannte Innenstadtfonds ein sinnvoller Beitrag. Hier wäre es wünschenswert, wenn entsprechende Mittel durch Landes- oder Bundesebene zur Verfügung gestellt werden könnten. Wichtig bei einer Förderung wäre, dass diese nicht in Wettbewerbs- oder ähnlicher Form ausgereicht wird, sondern dass der Zugang dazu, ohne bürokratische Hürden möglich ist und keine detaillierten Konzepte und ähnliches eingereicht werden müssen.
4. Strategien im Hinblick auf den Onlinehandel entwickeln
Die Entwicklung hin zu mehr und mehr Onlinehandel wurde durch die Corona-Zeit verstärkt und beschleunigt. Hier stellt sich die Frage, wie damit in Zukunft umzugehen ist und welche Positionen das Land dazu einnimmt. Eine grundsätzliche Entwicklung zu einer verstärkten Nutzung des Onlinehandels ist zu erwarten. Im politischen Raum wurden bereits Aspekte, wie eine Abgabe für den Onlinehandel, diskutiert, auch das Land Brandenburg sollte ein Konzept zum Umgang und zu den Auswirkungen des Onlinehandels entwerfen. Hier wird auch die Frage der Ausweitung und Erleichterungen von Sonntagsöffnungen mit einzubringen sein. Dorfläden als zentraler Ort besonders für kleine Gemeinden könnten ein lokales Gegengewicht zum Onlinehandel darstellen. Hier wären zeitgemäße und innovative Konzepte zu erproben.
5. Positive Entwicklungen der Corona-Pandemie ausnutzen
Bei der Entwicklung der Innenstädte sollten auch mögliche positive Effekte der Corona-Zeit mitgenommen werden. Durch die verstärkte Nutzung von Homeoffice und der damit verbundene Wegfall der Pendelwege waren und sind viele Menschen wieder verstärkt an ihrem Wohnort. Ländliche Gebiete dürften durch die Corona-Zeiten insgesamt als Wohnort und Lebensmittelpunkt an Attraktivität gewonnen haben. Durch die verstärkten Möglichkeiten im Homeoffice zu arbeiten, könnten so neue Konzepte wie Coworking-Bereiche und neue Mobilitätsangebote wie Carsharing auch in kleineren Städten oder ländlichen Gemeinden an Bedeutung gewinnen. Solche Trends und Entwicklungen sollten unterstützt und fortgesetzt und neue Nutzungen in den Innenstädten auch als Chance begriffen werden.
Beschlossen vom Präsidium des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg am 1. März 2021